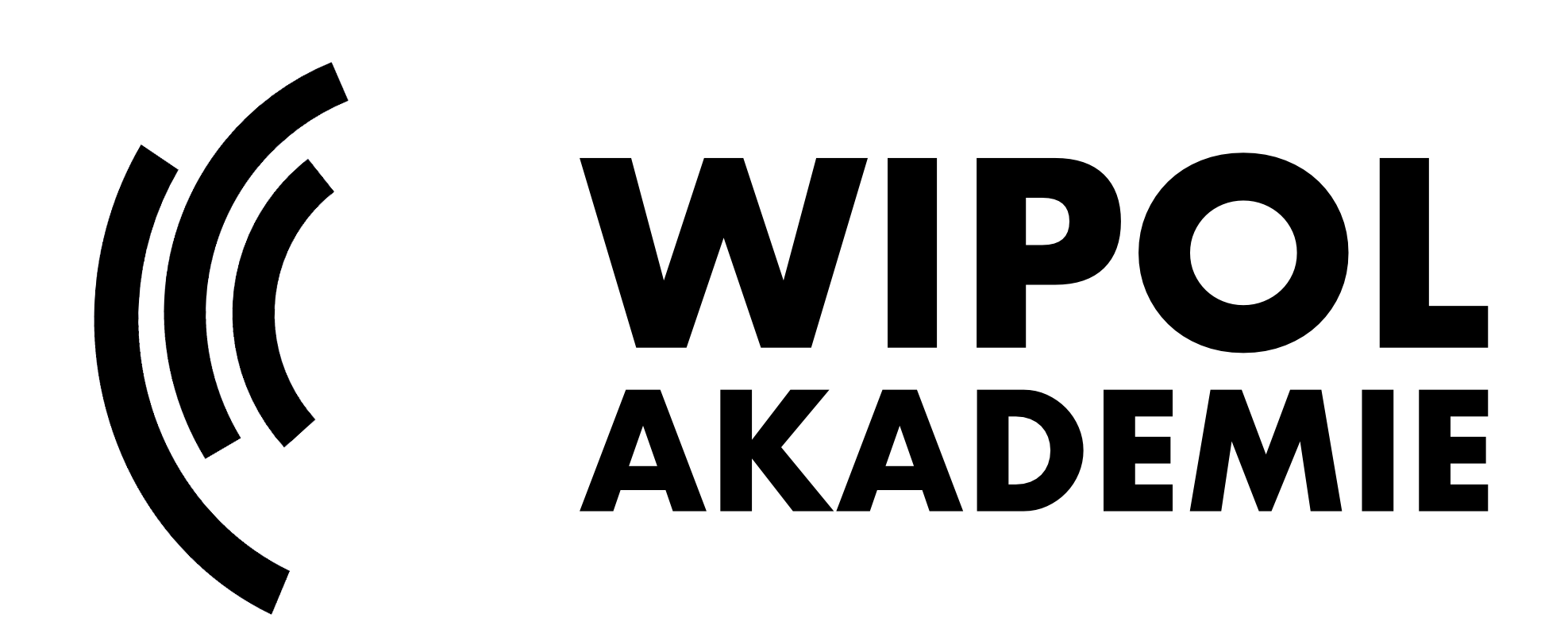Über die Rolle der Arbeit zwischen Realität und diskursivem Konstrukt.
Was früher vielleicht als Aufforderung gesehen wurde, doch endlich Feierabend zu machen, entspricht heute viel mehr der Maxime »Do what you love, love what you do«(1). Sprich, die Frage lautet eigentlich: Arbeitest du noch oder machst du schon sinnstiftende, erfüllende Arbeit? Und wenn nicht, wieso?
Wie wir aus Selbstratgebern, TED-Talks und Poetry-Slam-Beiträgen wissen, ist es doch eigentlich ganz einfach.
»Geh hinaus und mach etwas! Sei kreativ! Stell etwas auf die Beine! Zeig entrepreneurial spirit (oder vielleicht gar social entrepreneurial spirit)!«, so tönt es da hundertfach und erzählt von der Freiheit alles tun zu können.
Du hast die Freiheit alles zu tun, heißt nichts anderes, als du hast die Freiheit dir deine eigene Arbeit zu schaffen. Es gibt kein Recht auf Arbeit mehr, sondern vielmehr die Pflicht sich seine eigene Erfüllung zu schaffen. Das Finden erfüllender Arbeit ist dadurch zur Arbeit am eigenen Selbst geworden, denn hier, so wird verkündet, liegt der Ausgangspunkt – und das DWYL-Mantra ist damit ein zutiefst unsolidarisches Konzept. Wird die sinnstiftende Arbeit zum absoluten Konzept, dann liegt jede Verfehlung in der Verantwortung des Menschen – mangelnde Kreativität, mangelndes Engagement, mangelnde Begeisterung. Hier geschieht die Umkehrung einer Utopie ins Schreckliche, die oft der Welt der zweckfreien Kunst oder Wissenschaft zugeschrieben wurde. Hieß es früher noch »Architektur muss brennen«(2), so muss es heute heißen: Architekt*innen müssen brennen. Dann ist plötzlich klar, dass die Freiheit prekär oder im zehnten Praktikum zu arbeiten, nur der Logik eines absoluten Arbeitskonzepts folgt. Jene, die nicht genug brennen, haben sich das selbst zuzuschreiben. Jede Entbehrung und Erniedrigung wird als Beweis des Willens gesehen und die, die Arbeit verrichten, die kaum als sinnstiftend bezeichnet werden kann, müssen wohl einen selbstverschuldeten Mangel aufweisen.
Die erfüllende Arbeit selbst ist der Fetisch, der nur durch die Arbeit am Selbst erreicht werden kann. Sinnstiftende Arbeit ist das Spektakel, das alle Sphären des Lebens durchdringt und sie so selbst zur Arbeit macht – die Arbeit an der eigenen Person, die Beziehungsarbeit, die Arbeit am sozialen Netzwerk. Work-Life-Balance wird damit zum doppelt leeren Begriff – nicht nur dass ohnehin alles Leben zur Arbeit erklärt wurde; ist auch die Arbeit, die scheinbar ohne Zweck passiert, längst gekoppelt an die Lohnarbeit. Wer in der Freizeit gut netzwerkt, die Optimierungsarbeit an sich selbst erledigt hat und sich fit wie gesund hält, die*der wird dann möglicherweise mit dem erfüllenden Job belohnt.
DWYL – so what, Steve?
Es wird schnell vergessen, dass Arbeit jedoch auch mühsam, repetitiv, langweilig, belastend sein kann und deshalb faire Entlohnung, Arbeitnehmer*innenrechte und ein soziales Sicherheitsnetz benötigt. Außerdem stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich liebe etwas zu tun, das sich nicht zu Geld machen lässt oder dass ich nicht zu Geld machen will? DWYL verlangt schließlich die komplette Eingliederung in potentielle Produktionsverhältnisse, frei nach der Logik: Was sind Ressourcen schon wert, die nicht genutzt werden und wer beispielsweise Klavier spielt, trainiert doch auch nur Koordination, macht Gehirnjogging oder erwirbt kulturelles Kapital. Wie die Stars in der Gesellschaft des Spektakels, ist die erfüllende Arbeit nur das Bild einer Möglichkeit (3) – als Objekt der Identifikation, das vorherrschende Arbeitsverhältnisse verdeckt und die Frage, wieso so viele Menschen bereit sind, für so wenig Lohn tätig zu sein.
Hätte Steve Jobs (4) auch weiterhin getan, was er liebte, wenn er auf Werkvertragsbasis gearbeitet hätte, mit einem effektiven Gehalt unter dem Mindestlohn? Oder vielleicht hätte er öfters die Arbeiter*innen in Fertigungswerken oder die Verkäufer*innen in Apple-Shops fragen sollen, ob sie auch tun, was sie lieben? Dann hätte er sich auch die Frage stellen können, was seine Firma tut um sinnstiftende, menschenwürdige Arbeit zu ermöglichen und nicht die Verantwortung derartige Arbeit zu schaffen auf Arbeiter*innen abzuschieben.
März 2014
- Oder auch einfach DWYL – das Mantra wohl am prominentesten von Steve Jobs vertreten. (1)
- So titeln Coop Himmelb(l)au 1980, heute nehmen sie vor allem Praktikant*innen auf, die bereits zwei abgeschlossene Praktika vorweisen können. (2)
- Guy Debord. The Society of the Spectacle. London: Notting Hill Editions 2013, S. 32. (3)
- Feel free Steve Jobs hier durch beliebige Verkünder*innen des DWYL-Mottos zu ersetzen. (4)
Wolfgang Otter
war Teilnehmer des 6. Jahrgangs der Wirtschaftspolitischen Akademie 2013/14.