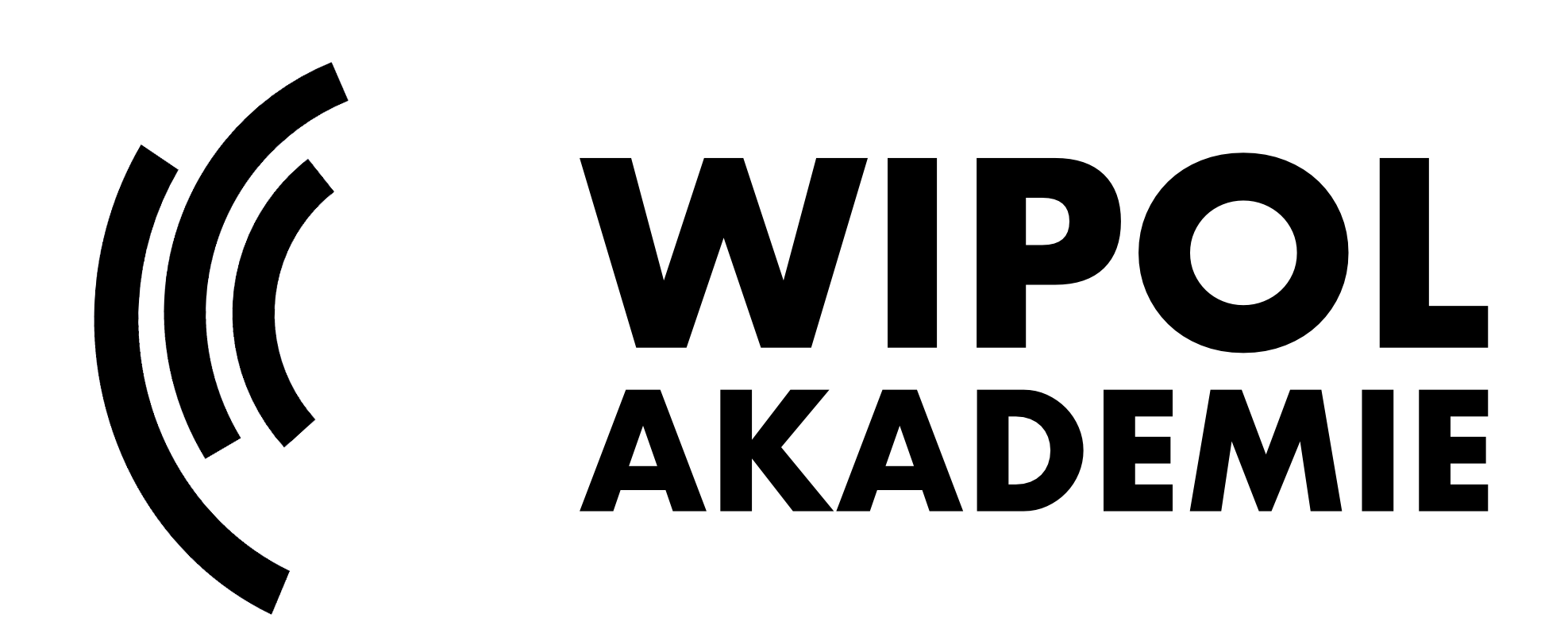– Die Frau aus dem Osten im österreichischen Pflegesystem
Vergangens Jahr veröffentlichte das WIFO eine Studie mit bemerkenswerten Prognosen für das österreichische Pflegesystem: Demzufolge dürften die Kosten für pflege- und betreuungsbedürftige Personen eine Steigerung um 360 Prozent bis zum Jahr 2050 erfahren. Dabei zeugt die gegenwärtige Situation keineswegs von überhöhten öffentlichen Investitionen wie ein anderer aktueller Bericht, nämlich jener der Volksanwaltschaft, zeigt. Er verweist auf Ressourcenmangel und Missstände an den ländergeführten Alten- und Pflegeheimen. Entsprechend überrascht es nicht, dass laut Arbeiterkammer im Jahr 2011 weiterhin 53% der PflegegeldbezieherInnen keine professionellen Dienstleistungen entgegennahmen – demgegenüber wurden nur 16% stationär betreut, 29% mobil, und 2% im Rahmen der 24-Stunden Pflege. Die Tatsache, dass noch immer ein großer Anteil an informellen häuslichen Arrangements besteht, ist vor dem Hintergrund einer Politik zu denken, die staatliche Infrastruktur hinter marktorientierten und bisweilen kostengünstigen Lösungen reiht. Grund genug jene Arbeiterinnen zu thematisieren, die auf dem Markt tätig sind und damit als Stütze für die Herausbildung neuer wohlfahrstaatlicher Arrangements durch den österreichischen Staat herangezogen wurden.
Pflege hinter verschlossenen Türen
Noch vor den ersten wesentlichen sozialpolitischen Maßnahmen in den frühen 1990er Jahren wurde Pflege über weite Strecken hinweg als Gegenstand des Privaten oder Familiären erachtet. In Folge des rapiden Wandels familiärer Strukturen, einer steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen, sowie eines Anstiegs pflegebedürftiger Personen (ebenfalls vorwiegend Frauen), hatten sich in Österreich aber längst sog. informelle transnationale Pflegeketten entwickelt. Das bedeutet, dass über Mund-zu-Mund Netzwerke vorwiegend Frauen aus östlichen Grenzregionen oder solche, die im Zuge der Jugoslawien-Kriege geflüchtet waren, in Haushalte geholt wurden, um dort ohne arbeitsrechtlichem Vertrag zu einem vereinbarten Entgelt zu arbeiten. Dies entsprach dem Bedarf privater österreichischer Haushalte ebenso wie den PflegerInnen, die aufgrund von oder trotz fehlendem arbeitsrechtlichen Status bereit waren, dadurch das eigene, oft nach Ursprungsort bemessene, Haushaltsbudget zu füllen.
Politische Etappe 1: Kaufkraft stärken, aber was damit anfangen?
Erst 1993 entschloss sich die österreichische Regierung zu einem erste politischen Eckpfeiler für ein formelles Pflegeregime mit der sogenannten Pflegevorsorge. Sie sah unter anderem die gesetzliche Schaffung eines steuerfinanzierten Pflegegeldes vor. Dieses wurde nun mehr entsprechend des Grades der Pflegebedürftigkeit in sieben Stufen gegliedert und individuell an die Betroffenen ausgezahlt. Gegenwärtig reicht es von 157,30 EUR in der ersten Stufe (>65h/Monat Pflegebedarf) bis 1688,90 EUR in der siebten Stufe (>180h/Monat Pflegebedarf). Es sollte die Kaufkraft und in weiterer Folge die Wahlmöglichkeit der pflegebedürftigen Personen steigern, zwischen häuslichen Arrangements und stationären Einrichtungen entscheiden zu können. Im weiteren Sinn spiegelt dies eine Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Arrangements nach einer marktorientierten Logik wider, deren grundlegende Idee in der Steuerung der markbasierten Selbststeuerung von Individuen liegt – diese sollen durch eine Stärkung der finanziellen Kaufkraft selbstermächtigt werden, Kompensationsfunktionen hinsichtlich sozialer/gesundheitlicher Problemlagen zu übernehmen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ also.
Zwar kann die Möglichkeit der Familienmitglieder-nahen Fürsorge durchaus auch als positiv betrachtet werden, jedoch erwies sich die politische Formulierung des bloßen „Beitrags“ statt einer vollständigen Finanzierung auch als Programm. So wurden Anpassungen der Beträge an die Inflationsrate gemieden und 1996 der Betrag für die erste Pflegestufe gekürzt. Bis 2009 kam es hingegen zu zweimaligen Erhöhungen, die allerdings so gering waren, dass die reale Kaufkraft in der Tat sank. Gleichwohl stellen wir gegenwärtig fest, wie jene Einrichtungen öffentlicher ambulanter und stationärer pflegebezogener Infrastruktur, die durch die Bundesländer hätten geschaffen werden müssen, nur zögerlich und im Vergleich sehr unterschiedlich ausgebaut wurden. Folglich wurde trotz des Pflegegeldes weiterhin stark auf illegalisierte Betreuungsverhältnisse mit ArbeiterInnen aus (Süd-)Ost-Europa gesetzt. Offenbar bedurfte es weiterer Anstrengungen, um einen entsprechenden weißen Markt zu schaffen.
Politische Etappe 2: Angebot schaffen, aber woher?
Dass eine selbst zustande gekommende Vollkommenheit des neuen Marktes nicht gegeben ist, dürfte wohl im Rahmen der 24-Stunden Pflege Debatte 2006 deutlich geworden sein. Trotz der spätestens 2011 zutage getretenen Sorgen um eine Verdrängung von ÖsterreicherInnen durch günstigere Arbeitskräfte aus den östlichen Nachbarstaaten wurden bereits 2007 Ausnahmeregelungen zu den Übergangsbestimmungen der EU-ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit für Pflege- und BetreuungsarbeiterInnen geschaffen. In diesem Sinne musste die Lösung für das Problem des mangelnden Angebotes also von irgendwo kommen und gerade in Hinblick auf die häusliche Betreuung kam sie gewissermaßen aus der Slowakei und Rumänien.
Die Gesetze zur sog. 24-Stunden Pflege ab 2007 schufen zunächst sowohl für Gepflegte als auch für PflegerInnen einen legalen Rahmen für die häusliche rund-um-die-Uhr Pflege. Fortan ist die Transnationalität eines Großteils der Pflegearbeit rechtlich abgesichert; nicht nur durch Ausnahmeregelungen im Aufenthaltsrecht, sondern auch jenen im Arbeitsrecht und auf Basis vertragsrechtlicher Erlaubnis für BetreuerInnen, sowohl selbstständig als auch unselbstständig für Privathaushalte oder Wohlfahrtsträger tätig zu sein. Damit wurden Hürden entlang mehrerer Politikfelder genommen, um so das Angebot auf dem weißen Markt zu stärken. Jene ArbeiterInnen, die bereit und fähig sind, vom Ausland kommend selbstständige oder unselbstständige Pflege zu leisten sind vorwiegend Frauen aus der Slowakei (47,1% jener Ausländ. mit sozialversicherungspflichtigem Einkommen) und aus Rumänien (36,9%).
Blind auf einem Auge
Und während deren Legalisierung nicht nur aus aufenthaltsrechtlicher, sondern auch sozialpolitischer Sicht eine Besserstellung für die Arbeiterinnen bedeutet, verbleibt das neue Pflegeregime ein zweischneidiges Schwert, gerade weil es in vielerlei Hinsicht eine Kontinuität informeller Arrangements darstellt. So zeigen jüngere empirische Studien zu formeller häuslicher Pflege wie etwa fixierte Regelungen zu Abwesenheits- bzw. Pausenzeiten fehlen, die angesichts des affektiven und damit entgrenzten Charakters der vollbrachten Arbeit häufig zu Ungunsten der ArbeiterInnen ausfallen. Ebenso verweisen WissenschaftlerInnen auf die geringe rechtliche Spezifizierung des Begriffs der Pflegearbeit, was in der Praxis zur Übernahme vielfältiger häuslicher Reproduktionsarbeiten führt. Zudem scheint auch die soziale Normbildung innerhalb der Betreuungsarrangements in familiären Kontexten weiterhin unterschätzt oder bewusst ignoriert zu werden, womit sozial und kulturell legitimierte Normen das relativ dünne rechtliche Rahmenwerk bisweilen unterwandern – Dankbarkeit konkurriert potentiell mit Entlohnung.
Folglich überrascht es auch aus Sicht der PflegerInnen nicht, dass informelle Pflegearrangements weiterhin dominieren. Und die politischen Reaktionen? Geht es darum, jene Frauen zu thematisieren, die einen beachtlichen Anteil der ArbeiterInnen formeller aber insbesondere informeller Pflege darstellen, so passiert dies vorwiegend im Kontext ihres Migrationshintergrunds. Dieser wird aber weniger dafür herangezogen, um etwa das Fehlen von Müttern, Töchtern oder Ehefrauen in dortigen Arbeits- und Lebensverhältnissen zu hinterfragen, sondern eher mit Blick auf die Verteilung hiesiger sozialer Leistungen für Nicht-StaatsbürgerInnen. Die gegenwärtige Debatte zur Indexierung des Bezugs der Kinderbeihilfe für im Ausland verbliebene Kinder macht dies mehr als deutlich. Woher kommt die Pflege und welchen gesellschaftlichen Wert trägt sie? Dies dürfte in Zukunft mehr als eine Kostenfrage werden.
Quellen:
Hammer, E., & Österle, A. (2001). Neoliberale Gouvernementalität im österreichischen Wohlfahrtsstaat. Kurswechsel 4 , S. 60-69.
Hochschild, A. (2000). Global Care Chains and Emotional Surplus Value. In T. Giddens, & W. Hutton, On the Edge: Globalization and the New Millenium (S. 130-146). London: Sage Publishers
Kretschmann, A. (2010). Verrechtlichung von 24-Stunden-Carearbeit in Österreich. In K. Scheiwe, & J. Krawietz, Transnationale Sorgearbeit – Rechtliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Praxis (S. 199-226). VS Verlag.
Österle, A. (2016). 24-Stunden-Betreuung und die Transnationalisierung von Pflege und Betreuung: Aktuelle Dimensionen und wohlfahrtsstaatliche Implikationen . In B. Weicht, & A. Österle, Im Ausland zu Hause pflegen. Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung (S. 247-270). Wien: LIT Verlag.
Schmid, T. (2010). Hausbetreuung in Österreich – zwischen Legalisierung und Lösung? . In K. Scheiwe, & J. Krawietz, Transnationale Sorgearbeit – Rechtliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Praxis (S. 171-198). VS Verlag .
https://www.news.at/a/pflege-caritas-fuer-oesterreichweit-einheitliche-standards-8124020
https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Pflege_und_Betreuung_2014.pdf
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360516.html
Ivan Josipovic war Teilnehmer des 9. Jahrgangs der Wirtschaftspolitischen Akademie