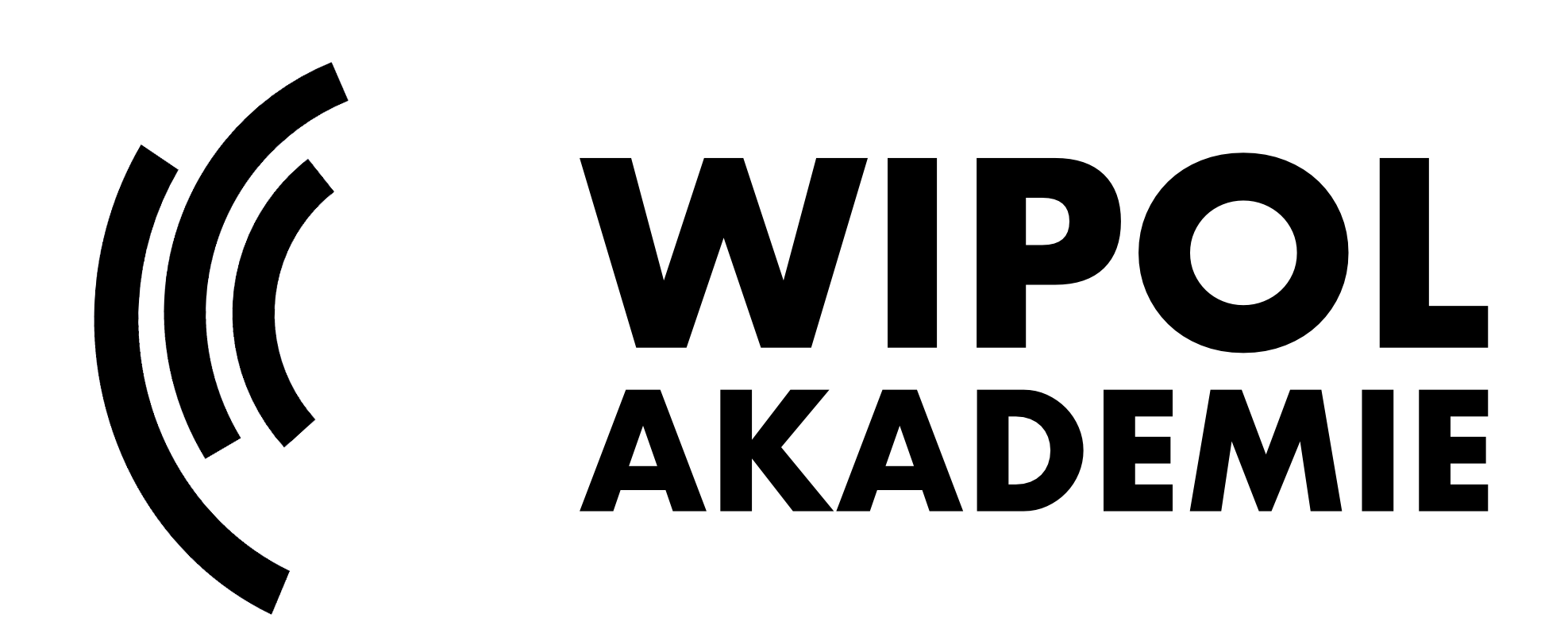Die soziale Lebensrealität von Studierenden. Wo die Studierendenförderung nicht funktioniert und was man dagegen machen kann. Versuch eines Lösungsvorschlags.
Das österreichische Studienförderungssystem geht grundsätzlich davon aus, dass alle Studierenden finanziell so abgesichert sind, dass sie ohne einen Nebenjob studieren können. Die Dunkelziffer jener Studierenden, die aus finanziellen Gründen erst gar kein Studium beginnen, ist unbekannt. Trotzdem sind laut aktueller Studierenden-Sozialerhebung vom Institut für Höhere Studien (IHS) 63% (!) aller Studierenden durchschnittlich 19,8 Stunden pro Woche erwerbstätig. Das lässt berechtigte Zweifel an der Treffsicherheit und am Funktionieren der österreichischen Studienförderung aufkommen.
Ein Schelm, wer Böses denkt
Grundsätzlich muss man an dieser Stelle schon vorausschicken: Sofern nicht anders angegeben beziehen sich alle Daten auf die aktuelle Ausgabe (Datenstand 2011) der Studierendensozialerhebung. Die Studierendensozialerhebung ist die größte und detaillierteste Befragung aller österreichischen Studierenden. Damit ist sie auch die größte Studie ihrer Art in ganz Europa. Sie ist seit 1999 in einem 3-jähigen Rhythmus erschienen (2002 erst nach 4 Jahren). Der Auftrag für die aktuellste Ausgabe wurde von der damaligen Wissenschaftsministerin Beatrix Karl jedoch ohne wirkliche Begründung um ein Jahr vorgezogen. Im Befragungsjahr trat auch die Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz in Kraft, die eine Kürzung der Altersgrenze bei der Familienbeihilfe um zwei Jahre vorsah. Fakt ist: Durch das Vorziehen der Studierendensozialerhebung, konnten die Auswirkungen des Familienbeihilfenverlustes nicht in die Studie eingearbeitet werden, da sie noch zu frisch war, um repräsentative Ergebnisse liefern zu können. Damit sind die Auswirkungen erst in der nächsten Studierendensozialerhebung enthalten, die voraussichtlich 2015 erscheinen wird und damit auch erst in der Legislaturperiode danach. Ob das politisch von der damaligen Wissenschaftsministerin so gewollt war? Ein Schelm, wer Böses denkt.
Immer mehr Studierende arbeiten immer länger
Analysiert man die Zahlen der Studierendensozialerhebung genauer, ergibt sich ein dramatisches Bild. Die Er-werbsquote, also der Anteil der Studierenden, die während des Semesters entweder durchgehend oder gelegentlich arbeiten, beträgt 63 Prozent (2009: 62%; 2006: 58%) Die Anzahl jener, die während des gesamten Semesters durchgehend beschäftigt sind ist seit 2009 auf 47 Prozent gestiegen (2009: 45%; 2006: 40%). Ebenso das durchschnittliche Erwerbsausmaß. Dieses ist im selben Zeitraum von 19,7 Stunden pro Woche auf 19,8 Stunden pro Woche gestiegen (2006: 19,1h). Für 75 Prozent aller berufstätigen Studierenden quer durch alle Hochschulsektoren ist das Hauptmotiv, arbeiten zu gehen, die „Notwendigkeit den Lebensunterhalt zu bestreiten“. Die häufigste Beschäftigungsform bilden prekäre Beschäftigungsverhältnisse, allen voran die geringfügige Beschäftigung. Knapp die Hälfte der erwerbstätigen Studierenden gibt an, Probleme zu haben, Studium und Job zu vereinen. Gut ein Drittel würde lieber weniger arbeiten, um sich auf das eigene Studium konzentrieren zu können. Viele könnten jetzt sagen: „Natürlich ist dieser Wert so hoch, immerhin gehen fast alle in den Ferien arbeiten.“ Dazu findet die Studierendensozialerhebung auch eine klare Aussage:
Die Erwerbsquote ist in allen Hochschulsektoren während des Semesters signifikant höher als in den Ferien. Der Großteil geht also während des Semesters arbeiten um sich das eigene Studium überhaupt leisten zu können.
Wir fassen zusammen: Immer mehr Studierende müssen immer mehr Arbeiten, um sich ihr Studium und ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können.
Berufstätigkeit bedingt durch das Geschlechts und der sozialen Herkunft
Trifft die Notwendigkeit eines Nebenjobs alle Studierenden gleichermaßen? Nein. Es gibt ein Gefälle zwischen hoher sozialer Herkunft – dort beträgt die Erwerbsquote 58,3 Prozent – und niedriger sozialer Herkunft, wo die Erwerbsquote wiederum 64,6 Prozent beträgt. Es gibt auch im durchschnittlichen Erwerbsausmaß pro Woche einen nicht unwesentlichen Unterschied. Bei Studierenden aus hoher sozialer Herkunft beträgt dieses nämlich 17,2 Stunden pro Woche und bei Studierenden aus niedriger sozialer Herkunft wiederum 23,4 Stunden. (Durchschnitt über alle Schichten: 19,8 Stunden pro Woche) Wenn man sich das Motiv, einem Job nachzugehen, näher ansieht, dann wird dieser Unterschied noch deutlicher. Studierende aus höherer sozialer Herkunft geben zu 60 Prozent an, arbeiten zu gehen, um sich den Lebensunterhalt finanzieren zu können, während 86 (!) Prozent aller Studierenden aus niedriger sozialer Herkunft dasselbe angeben. Diese Kluft zeichnet sich auch im Geschlechtervergleich ab. Männer weisen eher die Tendenz auf, konstant in einem Beschäftigungsverhältnis zu stehen, während Frauen eher in mehreren (prekären) Jobs tätig sind und das oft gleichzeitig. Männer arbeiten viel öfter in Berufen in Zusammenhang mit dem Studium, was sich auch in der Bezahlung wiederspiegelt. In Beschäftigungsverhältnissen mit weniger als 400 Euro im Monat sind Frauen deutlich überrepräsentiert.
Löchrige Studien- und Familienbeihilfe
Der weit verbreitete Myhos, Studierende würden über Studien- und Familienbeihilfe ohnehin genug Geld be-kommen hält einer nüchternen Betrachtung der Zahlen nicht stand. Gerade einmal jede und jeder zweite Studierende bekommen Familienbeihilfe (2011: 53%). Diese Quote ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. (2009: 55,1%; 2006: 58,6%) Zwei Dinge sind hier noch zu beachten: Diese Ergebnisse beinhalten noch nicht die Auswirkungen der Familienbeihilfenkürzung! Ebenfalls zu beachten ist, dass nicht die Studierenden selbst, sondern lediglich ihre Eltern Anspruch auf die Familienbeihilfe haben. In vielen Fällen wird diese von den Eltern nicht an die studierenden Kinder weitergegeben. Kürzlich jedoch wurde jedoch der Behördengang vereinfacht, der es Studierenden ermöglicht, per Antrag, die Familienbeihilfe direkt auf das eigene Konto überwiesen zu bekommen. Bei der Studienbeihilfe ist die Situation noch dramatischer. Lediglich 14,7 Prozent aller Studierenden beziehen die klassische Studienbeihilfe. (2009: 18,2%; 2006: 18,6%) Die durchschnittliche Höhe der klassischen Studienbeihilfe beträgt lediglich 272,00 Euro (Höchstgrenze 474,00 bzw. 679,00 Euro). Weit entfernt von einem existenzsichernden Beitrag.
Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf
Als wäre das marode Studienförderungssystem und die Not zur Berufstätigkeit nicht schon schlimm genug, sind österreichische Beihilfen und die Studiengebührenbefreiung an eine Mindeststudienzeit mit Toleranzsemestern gebunden. (Bei der Studienbeihilfe gibt es im Bachelor ein Toleranzsemester, in Diplomstudien ein Toleranzsemester pro Abschnitt ¬– Bei der Familienbeihilfe sind es jeweils zwei Toleranzsemester) Wo hier das Problem liegt? Wenn Studierende sich nicht auf ein Vollzeitstudium konzentrieren können, weil sie nebenbei ihren Lebensunterhalt durch Berufstätigkeit bestreiten müssen, dann verzögert sich dementsprechend auch die Studiendauer. Was mehr an Zeit für den Nebenjob aufgewandt wird, muss beim Studium wieder abgezogen werden. Vor allem Studierende aus niedriger sozialer Herkunft laufen damit Gefahr, die Mindeststudiendauer inklusive Toleranzzeit zu überschreiten. Dann sehen sich gerade sie mit dem Wegfall von Beihilfen und womöglich sogar dem Eintreten der Studiengebührenpflicht konfrontiert. Diese finanziellen Mehrbelastungen müssen dementsprechend durch höheren Arbeitsaufwand im Nebenjob kompensiert werden, oder wieder bei Frauen häufiger der Fall: Durch eine zusätzliche prekäre Anstellung. Dies führt wiederum zu einer noch massiveren Verzögerung im Studium oder gleich zum Studienabbruch. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie von Franz Kolland, die einzige Studie zu den Gründen von Studienabbrüchen, die bundesweit in diesem Ausmaß je durchgeführt wurde. Demnach ist der häufigste Grund für Studienabbrecher_innen die Unvereinbarkeit von Job und Studium (55 Prozent). Am wenigsten relevant sind aus Sicht der Befragten zu hohe Leistungsanforderungen (17 Prozent) bzw. dass Prüfungen nicht bestanden wurden (11 Prozent). Der Mythos, Studienabbrecher_innen wären nicht geeignet für ein Studium hat kein faktisches Fundament. Vielmehr liegen die Gründe dafür in der mangelnden sozialen Absicherung.
Das Grundstipendium als Ausweg?
Eine Forderung, die bei jeder solchen Diskussion aufkommt, ist das Konzept des Grundstipendiums. Was ist das überhaupt? Es ist ein an alle Studierende monatlich ausbezahlter Fixbetrag. Im Gegensatz zur bedarfsorientierten Mindestsicherung, gibt es hier keine Bedürftigkeitsprüfung. Warum das in diesem Fall gerechtfertigt ist? Aus dem einfachen Grund, dass über alle Studierenden (auch diejenigen, die in erster Linie berufstätig sind und nebenbei Studieren) gerechnet, ein durchschnittliches Gesamtbudget von 1.003,00 Euro zur Verfügung steht. Davon sind 863,00 Euro Einnahmen aus Geldleistungen, der Rest Naturalleistungen (Vor allem Unterstützungen der Eltern). Klar ist, dass Studierende aus niedriger sozialer Schicht a) weniger Gesamtbudget insgesamt zur Verfügung haben und b) bei ihnen überproportional wenig Naturalleistungen vorhanden sind (58 Prozent der sozial schwachen Studierenden geben an, wegen fehlender Unterstützung der Eltern finanzielle Probleme zu haben). Dem gegenüber stehen durchschnittliche Gesamtkosten von 931,00 Euro gegenüber. Zum Vergleich: Die aktuelle Armutsgefährdungsschwelle liegt bei 1.066,00 Euro (diese überschreiten Studierende erst durchschnittlich mit 28 Jahren). Sage und schreibe 69,1 Prozent aller Studierenden haben ein Gesamtbudget, das darunter liegt! Wir haben hier einen überproportional hohen Grad an Bedürftigkeit, bei dem einerseits die Verwaltungskosten, den anderen 30 Prozent ebenfalls ein Grundstipendium auszuzahlen, wahrscheinlich höher wären, als das Ersparnis dadurch. Andererseits würde auch diese Studierende davon profitieren, da sie die Möglichkeit hätten, weniger arbeiten zu müssen und schneller zu studieren. Das Mittel schlechthin, das Studium zu beschleunigen, ist eine ausreichende finanzielle und existenzsichernde Absicherung.
Die Höhe dieses Grundstipendiums seit jeher kontrovers diskutiert. In zwei Punkten ist man sich aber grundsätzlich einig. Es soll analog zum PensionistInnenpreisindex ein eigener Studierendenpreisindex eingeführt werden, der studierendenspezifische Kosten besonders berücksichtigt. Der andere Punkt ist, dass das Grundstipendium auf jeden Fall so hoch angesetzt werden soll, dass die Studierenden zu keinem Zeitpunkt zu einem Leben in Armut gezwungen ist. Sinnvoll scheint es mir, zumindest in der Höhe der durchschnittlichen Einnahmen aus Geldleistungen anzusetzen, da dieser am häufigsten mit Erwerbsarbeit verbunden ist und man gerade diesen Bereich auf das Notwendigste zurückstutzen sollte, um besagt Studienbeschleunigung in Gang zu setzen. Ein bereit sehr detailliert ausgearbeitetes Modell dazu hat die Bundesvertretung der Österreichische HochschülerInnenschaft in ihrem alternativen hochschulplan Forum hochschule II ausgearbeitet, dessen Lektüre ich dringend ans Herz lege.
Anspruch auf ein Grundstipendium hätten alle, die an einer österreichischen Hochschule studieren, Nostrifikationsverfahren durchlaufen oder sich auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereiten. Für das Grundstipendium gibt es keine Altersgrenze, da starre Altersgrenzen, das zeigt die aktuelle Familienbeihilfenregelung sehr deutlich, verschiedene Bildungsbiografien völlig ignorieren. Als AbsolventIn einer Handelsakademie verliere ich zB ein Jahr, aufgrund einer Schulauswahl, die mit 14 getroffen wurde. Jedoch gibt es auch beim Grundstipendium eine Höchststudiendauer. Hierfür wird statt der Mindeststudiendauer die tatsächliche durchschnittliche Studiendauer herangezogen, da diese ein realistischerer Maßstab ist, als die Hausnummer, die sich hinter der Bezeichnung Mindeststudiendauer versteckt. Der Bachelor Wirtschaftswissenschaften an der JKU hat eine Durchschnittsstudiendauer von etwa 10 Semestern. Jedoch bekommt man für selbigen lediglich acht Semester lang Familienbeihilfe bzw. 7 Semester lang Studienbeihilfe. Oft wird auch als Argument für Studiengebührengebühren genannt, man könne endlich die Karteileichen aus den Unis loswerden, und würde somit die durchschnittliche Studiendauer bereinigen, sprich: statistisch verkürzen. Die Praxis jedoch zeigt ein anderes Bild. Erst in der Zeit als die Studiengebühren unter Bundesministerin Gehrer (ÖVP) eingeführt worden sind, hat sich besagte Durchschnittstudienzeit von 12 auf 14 Semester erhöht, obwohl knapp 14.000 Studierende von einem Semester auf das andere ihr Studium abgebrochen haben. Hauptgrund dafür ist der oben beschriebene Teufelskreis zwischen Arbeitszwang und mangelnder sozialer Absicherung. Auch dieser Mythos hält nicht stand.
Fazit
Die Auswirkungen wären simpel und innovativ zugleich. Zu allererst würde es die Notwendigkeit eines Nebenberufes zur Finanzierung des eigenen Studiums beseitigen, was wiederum zur Folge hätte, dass alle unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft die gleichen Chancen hätten, ein Studium zu beginnen. Durch den Wegfall des Erwerbszwanges würde sich die Durchschnittsstudiendauer verkürzen. Während des Studiums hätten alle die Möglichkeit sich voll und ganz auf das eigene Studium zu konzentrieren. Die Abhängigkeit von den Eltern in der Wahl der Studienrichtung und der soziale Absicherung würde ebenfalls wegfallen, was allen gleichermaßen ein selbstbestimmtes, unabhängiges und eigenverantwortliches Studium ermöglichen würde. Die Diskussion um die Mindestsicherung hat eines gezeigt: Es scheitert nicht an der Machbarkeit, sondern am politischen Willen, zu handeln. Das Grundstipendium, der freie Zugang zu Bildung und damit die adäquate soziale Absicherung von Studierenden ist das Gebot der Stunde.
Foto: Alexander GotterMario Dujakovic
ist 24 Jahre alt, studiert Rechtswissenschaften an der Uni Wien und war Referent für Sozialpolitik an der ÖH Linz, im Öffentlichkeitsreferat der ÖH-Bundesvertretung und ist Teilnehmer der Wirtschaftspolitischen Akademie 2013/14.