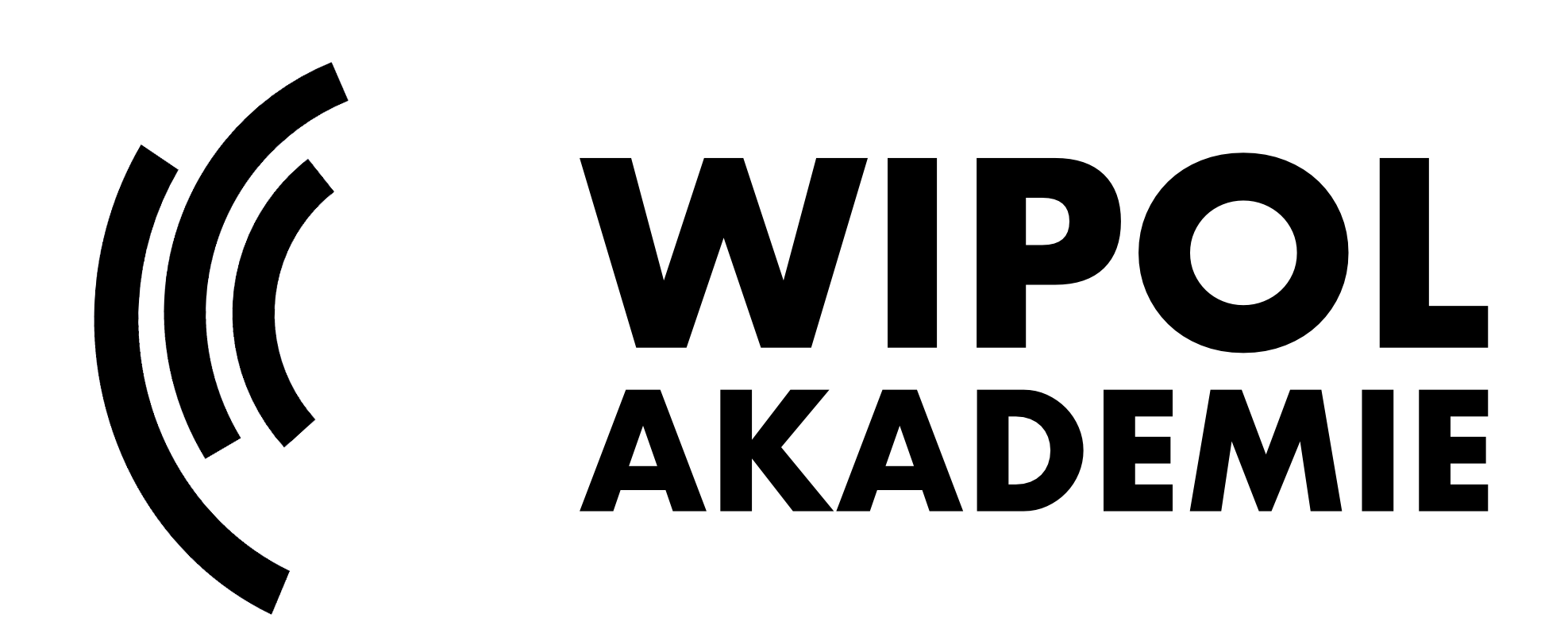Wir – das sind in Österreich aktuell gerade 8,7 Millionen Menschen. Wir wachsen ständig, und das passiert auf Basis von Migration, weil wir ja durchschnittlich weniger Kinder haben. Zusätzlich gibt es in Österreich etwa gleich viele Frauen* wie Männer*, und wir können ständig älter werden, weil die Lebenserwartung steigt. Das – und noch viel mehr – sind alles Dinge, die wir aus Statistiken wissen, aus Ansammlungen von Zahlen, die mit mathematischen Verfahren bearbeitet werden. Wir kommen so gut wie keinen Tag ohne sie aus, denn sie beeinflussen nicht nur öffentliche Diskussionen, beispielsweise, wie sich das derzeitige Pensionsmodell verändern muss, um der Überalterung (=wenige junge Menschen im Vergleich zu über 65-Jährigen, die nicht mehr erwerbstätig sind) entgegenzutreten. Sie beeinflussen auch, in welchen Kategorien wir denken – jede*r von uns hat schon Fragebögen oder Formulare ausgefüllt, die die Grundlagen dieser Statistiken bilden. Wir wissen, dass diese Daten dann in ein Computerprogramm eingetippt und statistisch analysiert werden. In der Schule haben wir gelernt, dass wir mit mathematischen Rechenformeln auf eindeutige Lösungen kommen – da gibt es kein ‚fast richtig‘, die Lösung ist entweder richtig, oder falsch. Wissenschaft, die mit Zahlen arbeitet, ist außerdem objektiv, das heißt von Werten unbeeinflusst, neutral und versucht nur das zu ergründen, was ohnehin schon ist, oder passiert. Wer dabei konkret welchen Schritt ausführt, ist unwichtig – wichtig ist vielmehr, dass die Resultate exakt so neuerlich geschaffen werden können, gegeben, dass sich die Umstände nicht verändern.
So oder so ähnlich wird über quantitative (grob: zahlenbasierte) Forschung gedacht. Gleichzeitig ist das eine sehr verkürzte Darstellung von dem, was im Forschungsprozess tatsächlich passiert. Diese Kritik kommt von vielen unterschiedlichen Denkrichtungen, unter anderem auch aus feministischen Strömungen, wie beispielsweise der Standpunkttheorie, auf deren Argumente ich mich beziehe.
Was stimmt denn also mit dieser Neutralität und Objektivität nicht? Das hat mit einer bestimmten Vorstellung von dem zu tun, was wir unter Wissen verstehen, und wie dieses zustande kommen kann. Wir alle, ob Wissenschaftler*innen, Forscher*innen oder auch Menschen außerhalb des wissenschaftlichen Betätigungsfeldes, haben gelernt bestimmte Dinge anhand bestimmter Kategorien einzuordnen. Diese Kategorien sind nicht notwendigerweise zwingend überall genau so, sondern kulturell, historisch und sozial geformt. Das wohl eindeutigste Beispiel hier sind Farben – die Farbwahrnehmung und entsprechende Kategorisierung variiert schon im eigenen Freund*innenkreis bedenklich. Kommen zusätzlich noch andere Sprachkulturen hinzu, wo es beispielsweise bestimmte Farbtöne nicht als einzeln benannte Kategorie gibt, wird diese Varianz noch deutlicher. Ein anderes Beispiel – wir sind gewohnt Menschen ganz eindeutig als männlich und weiblich einzuteilen, ein Bild, das auch wissenschaftliche Studien immer wieder stützen, indem Untersuchungen zu diesen eindeutigen Differenzen zwischen den Geschlechtern gemacht werden. Gleichzeitig wird hier ausgelassen, dass Menschen nicht immer – auch nur in Bezug auf ihre körperlichen Merkmale bzw. Geschlechtschromosomen, von der eigenen Identität ganz zu schweigen – eindeutig zuordenbar sind (1). Andere Kulturen kennen beispielsweise auch mehr als nur zwei ‚biologische‘ Geschlechter (2). Unser sozial-kulturelles Umfeld prägt also, wie und ob wir bestimmte Dinge wahrnehmen und einordnen, um mit der Komplexität des Alltags fertig zu werden.
Wie kann es dann also sein, dass Wissenschaft all diese Vorannahmen ausblendet? Das kann doch gar nicht funktionieren – immerhin sind wir immer noch körperlich in unser Umfeld eingebunden – es ganz zu verlassen scheint also bereits auf dieser rein materiellen Ebene gar nicht möglich. Und auch die Wahl von Forschungsfragen, die Entscheidungen, die getroffen werden, um diese Fragen zu bearbeiten, die untersuchte Gruppe, die Form, wie Daten gesammelt und ausgewertet werden – all diese Entscheidungen sind in der quantitativen Methodenlehre mehr oder weniger als dem wissenschaftlichen Prozess vorgelagert ausgeklammert. Ganz eindeutig aber beeinflussen sie das Ergebnis. Diese Ergebnisse sind nicht nur im Wissenschaftskontext relevant, sie haben auch politischen Einfluss, da sie oft Ausgangspunkt oder Grundlage politischer Maßnahmen werden – beispielsweise in oben bereits erwähnter Sicherung des Pensionssystems. Gerade dieser Einfluss soll durch Objektivität verhindert werden. Was aber, wenn das doch gar nicht möglich ist wirklich neutrale, unbeeinflusste Forschung zu betreiben? Welche Interessen werden als Konsequenz dadurch vertreten?
Das sind die Interessen der Wissenschaftler*innen, bzw. meist der Wissenschaftler*, also einer privilegierten Gruppe unseres Gesellschaftssystems, welche zu dem Sechstel der österreichischen Akademiker*innen zählen. Wie wir wissen, ist unsere Bildungskarriere sehr stark von der unserer Eltern beeinflusst. Akademiker*innen bekommen kleine Akademiker*innen, Arbeiter*innenkinder hingegen schaffen es nur vergleichsweise selten auf die Unis. Diejenigen, die also Wissen über uns produzieren, sei es jetzt naturwissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich, zählen damit – erwerbsbiographisch gesehen – bereits zu den privilegierteren Schichten mit höherem Einkommen und geringerer Arbeitslosigkeit, von Wohnsituation, Mobilität etc. ganz zu schweigen. Ihre Lebensrealität beeinflusst dabei ihr Interesse, die Fragen die sie stellen und auch wie sie diese Fragen stellen. Aber wie soll diese privilegierte Gruppe von Menschen die Lebensrealität der anderen, weniger privilegierten Menschen verstehen? Sind die Fragen, die Forscher*innen stellen auch für die interessant und relevant, die sie letztlich betreffen (3)?
Können wir uns in den abstrakten aber gleichzeitig breit formulierten Kategorien von Statistiken wiederfinden? Auch alteingesessene Kriterien wie männlich oder weiblich und die daran geknüpfte Analyse davon, wie unterschiedlich wir denn nicht sind, sind zu hinterfragen und verdecken die Vielfältigkeit von Frauen* und Männern* untereinander. Je nachdem, ob sie zum Beispiel aus privilegierten oder diskriminierten Verhältnissen stammen, welche Hautfarbe sie haben, welche sexuelle Orientierung, Nationalität, Migrationserfahrung, körperliche Beeinträchtigung sie haben, unterscheiden sich auch ihre Lebensrealitäten. Als Wissenschafter*innen müssen wir diese mitdenken, um tatsächlich relevantes Wissen zu schaffen. Wie wäre es, das Verhältnis von Wissenschafter*innen zu ihren Untersuchten näher zu thematisieren und dabei auch Hierarchien, die zwischen den Expert*innen und Lai*innen bestehen, zu beleuchten? Wir leben in einem System voller Ungleichheiten, das bestimmte Gruppen bevorzugt, und andere strukturell benachteiligt – dieses Ungleichgewicht muss auch im Forschungsprozess mitgedacht und betrachtet werden, um Lebensrealitäten eben realitätsnah abzubilden und gleichzeitig keine unnötigen Hierarchien zu stützen.
Wenn jetzt Wissenschaft aber weiter als objektiv und wertfrei wahrgenommen wird, wie sollen dann die ganzen Vorannahmen, die meist unbewusst getroffen werden, sichtbar gemacht und diskutiert werden? Wie sollen Machtunterschiede thematisiert werden, wenn sie doch in der quantitativen Methodenlehre überhaupt nicht angesprochen werden? Wir brauchen dieses andere Verständnis von Wissen, von dem, was gute Wissenschaft ausmacht. Und aus einer feministischen Perspektive ist das ganz klar ein Wissen, das die Position der weniger Privilegierten ernstnimmt und diese beleuchtet, um so strukturelle Probleme zu identifizieren und auch verändern zu können. In dieser Perspektive sind manche Werte vielleicht auch gar nicht schlecht. Warum denn Demokratie, Empathie oder Gerechtigkeit ausklammern? Wären das nicht Werte, die das von uns geschaffene Wissen besser machen, und vor allem beträchtlich ausweiten würde?
(1) Ein sehr bekanntes Beispiel hier ist die spanische Hürdenläuferin María José Martínez-Patiño, welche ihre Sportkarriere beenden musste, weil sie laut einer chromosomalen Untersuchung nicht eindeutig als weiblich klassifiziert werden konnte. Ihre Geschichte ist hier nachlesbar: ttp://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673605678415.pdf
(2) In Nepal zum Beispiel können seit Jänner 2013 drei offizielle Geschlechter angegeben werden. Der Wikipedia Artikel zum „Dritten Geschlecht“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Geschlecht) gibt einen kurzen rechtlichen Überblick anderer Länder. Zur kulturellen Formung und Erlernung von Geschlecht aus ethnographischer Perspektive siehe zum Beispiel: Lipp, Wolfgang (1986) Geschlechtsrollenwechsel: Formen und Funktionen am Beispiel ethnographischer Materialien, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 38, H. 3, 1986, S. 529-559.
(3) Werden weniger privilegierte Gruppen, beispielsweise Menschen der unteren Einkommensschichten, im heutigen Wissenschaftskontext untersucht, werden die übrigen, in dem Fall also die reicheren Einkommensgruppen, automatisch aus der Diskussion ausgeschlossen. Reich(er) zu sein wird nicht problematisiert oder thematisiert, und damit zur Norm anhand derer die Ärmeren gemessen werden. Und das wiederum führt ganz oft dazu, dass die strukturelle Komponente von Einkommensverteilung hinter individuellen Eigenschaften verloren geht, dass Menschen folglich als ärmer dargestellt werden, weil sie keinen anderen Bildungsweg gewählt haben, oder weil sie eben nicht jeden Job annehmen wollen.
(*) Titelbild von https://ellenjdasilva.com/category/june-2014/
Der Blogeintrag stellt eine gekürzte und angepasste Variante meiner Masterarbeit dar, die ich zu dem Thema „Counting People, not Objects. A Feminist Standpoint Theoretical Perspective on Demographic Data Collection“ im Masterstudiengang Socio-Ecological Economics and Policy unter der Betreuung von Katharina Mader auf der WU schreibe.
Lisa Marie Seebacher ist Teilnehmerin des 8. Jahrgangs der Wirtschaftspolitischen Akademie.